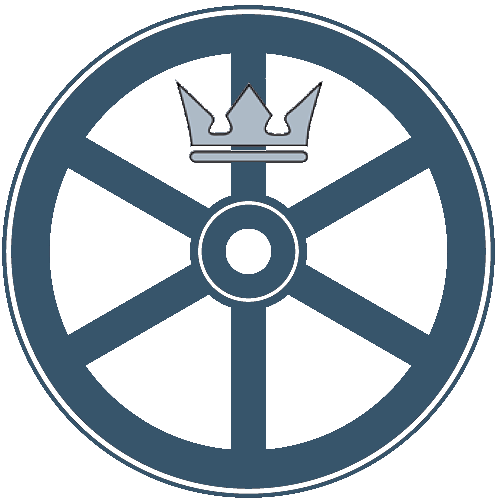Schüler der Klassen 5 des Gymnasiums der Benediktiner pflanzen ihren Klassenbaum
Schüler der Klassen 5 des Gymnasiums der Benediktiner pflanzen ihren Klassenbaum
Auch in diesem Jahr pflanzten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 drei Apfelbäume auf die Streuobstwiese der Abtei Königsmünster, jeweils einen Baum pro Klasse.
(entnommen aus dem RUNDBRIEF 1997, S. 13ff)
Die Schulchronik des Schuljahres 1946 beginnt mit einem Rückblick auf die Jahre des Nationalsozialismus, die für die Schule und das Kloster einen tiefen Einschnitt in ihre Geschichte bedeuteten.
"Im Laufe des Jahres 1945 kehrten die am 19.03.1941 vertriebenen Benediktiner wieder in ihr Kloster Königsmünster in Meschede zurück. Was der letzte Chronikschreiber der ehemaligen höheren Schule der Benediktiner in Meschede beim Abschied von der Schule in der damaligen Situation kaum als leise Hoffnung auszusprechen wagte, ist durch Gottes barmherzige Fügung Wirklichkeit geworden, wenn auch unter größter Erschütterung unseres Volkes, an der wir alle, ob schuldig oder unschuldig, mitleiden. Nur mit tiefer Bewegung geht der damalige Schulleiter und Chronikschreiber daran, nach etwa sechsjähriger Unterbrechung die Chronik fortzusetzen."1
Die Wehen des Nationalsozialismus hatten vor den Toren des Klosters und der höheren Schule nicht Halt gemacht. Das nationalsozialistische Gedankengut bestimmte immer mehr den Schulunterricht, Gedenkstunden ehrten die Helden des Vaterlandes und über aller Erziehungsarbeit an den Jugendlichen wachten die Partei und ihre Organe. Die Lehrerschaft, insbesondere die ordenseigenen Lehrkräfte, mußten immer häufiger mit Repressalien rechnen. Am 29. März 1941 teilte der Mescheder Bürgermeister Scherf dem Oberpräsidenten für das Höhere Schulwesen in Münster mit, daß auf Wunsch des Herrn Oberschulrats Sanden das von den Benediktinern unterhaltene Schülerheim in die Regie der Stadt übernommen worden sei.
 Im zweiten Halbjahr in der 9. Klasse geht es im Wahlpflichtfach GEWI (Gesundheit und Wirtschaft) um die großen Themenblöcke „Zivilisationskrankheiten“ und „Sucht“. Der Vorteil solcher Wahlpflichtkurse ist, dass man dort etwas mehr Freiheiten hat, was die Themenauswahl betrifft, sodass der Unterricht noch stärker am Interesse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet werden kann.
Im zweiten Halbjahr in der 9. Klasse geht es im Wahlpflichtfach GEWI (Gesundheit und Wirtschaft) um die großen Themenblöcke „Zivilisationskrankheiten“ und „Sucht“. Der Vorteil solcher Wahlpflichtkurse ist, dass man dort etwas mehr Freiheiten hat, was die Themenauswahl betrifft, sodass der Unterricht noch stärker am Interesse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet werden kann.
Weiterlesen: Unterricht mit Grips! – Gehirnpräparation in der Schule
"Kampf um die Jugend bedeutet für jedes totalitäre System letztlich Kampf ums eigene Überleben, denn mit der Jugend soll der 'neue Mensch' heranwachsen, der das Überleben des Systems garantiert, der die Glaubenssätze der herrschenden Ideologie so verinnerlicht hat, daß sie ihm nie mehr zweifelhaft werden. Im nationalsozialistischen Deutschland war dies der Glaube an den 'Führer' als die Gestalt des innerweltlichen Erlösers, der Glaube an die Überlegenheit der arischen Rasse, an den Weltherrschaftsanspruch Deutschlands und nicht zuletzt an die Einigkeit aller Deutschen, garantiert durch eben die genannten Glaubenssätze, die Herrschaft der NSDAP und die Erfassung aller Deutschen in dieser Partei, ihren Gliederungen und Nebenorganisationen",
so beginnt Joachim Kuropka seine Darstellung über Schule und Jugenderziehung in seinem Artikel: "Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Münster"1.
Weiterlesen: Die höhere Jungenschule zu Meschede im Nationalsozialismus - Teil I
(entnommen aus dem RUNDBRIEF 1996, S. 11ff)
In totalitären Staaten geht die Gewinnung der Jugend einher mit der Zukunftssicherung des Herrschaftssystems. Die Erziehung und damit vor allem die Schule gewinnt eine zentrale Bedeutung. Im Dritten Reich war die Hauptfunktion die Vermittlung nationalsozialistischer Werte und Weltanschauungen.
"Der Indoktrination und Ideologievermittlung auf inhaltlicher Ebene entsprach die Zentralisierung und Ausschaltung konkurrierender Erziehungsmächte in organisatorisch-institutioneller Hinsicht. Hier waren die Kirchen in doppelter Weise im Weg: Einmal ging es um die Verdrängung des Religionsunterrichtes, religiöser Symbole und kirchlichen Einflusses überhaupt, zum anderen speziell um den Abbau und die Beseitigung der konfessionellen Bekenntnis- und Privatschulen."1
Durch das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933, Artikel 21 bis 24, glaubte man innerhalb der kirchlichen Kreise die Existenz von Religionsunterricht und Bekenntnisschulen gesichert.2 In diesem staats- und völkerrechtlichen Abkommen sahen kirchliche Amtsträger ein Dokument, durch das ein evtl. Vertragsbruch der Nationalsozialisten in aller Öffentlichkeit angeprangert und die Einhaltung des Vertrages gefordert werden könnte. Doch sollte die Koexistenz von katholischer Kirche und NS-Regime nicht allzu lange anh
alten. Spätestens ab Winter 1933/34 kam es zu vermehrten Zusammenstößen der sich nun gegenüberstehenden Konkordatspartner.3
Weiterlesen: Die höhere Jungenschule zu Meschede im Nationalsozialismus - Teil II
(entnommen aus dem RUNDBRIEF 1994, S. 13ff)
Nach einer alten Redensart häufen sich die Feste, Jubiläen und Gedenktage, je älter ein Mensch wird. Ebenso ist es mit einer Schule, die in die Jahre kommt. In diesem Jahr können wir auf zwei solcher Festtage zurückblicken: Vor 135 Jahren wurde die höhere Schule der Stadt Meschede gegründet; vor 60 Jahren übernahmen die Benediktiner von Königsmünster die Leitung der Schule.
Ich möchte hier an die Übernahme der Rektoratsschule durch den Benediktinerkonvent erinnern und ein Wort von P. Prior Linus Leberle OSB an den Anfang setzen: "Ein Stück unserer Aufgabe ist die Schule", so umschrieb P. Prior im Jahresbericht 1934 die neue Aufgabe des Benediktinerklosters.
Weiterlesen: Eine Schule kommt in die Jahre - Mosaiksteine aus der Schulchronik
- Das ist die neue SV!
- Neue Schlafsäle für Mvimwa
- Schülerkunstausstellung 2023 in der Fachhochschule Meschede
- Kunstausstellung und Prämierung der besten Arbeiten 2022
- Fulminantes „Vorweihnachtliches Konzert“ des „Gymnasiums der Benediktiner“
- Schulung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt
- Das haben wir gemacht! Gemeinsam!
- Rückblick auf den Distanzunterricht – Entwicklungsaufgaben für die Zukunft